Aktuelle
Events

Katja ist Buchhändlerin in unserer Tyrolia-Filiale in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck und leidenschaftliche Leserin.
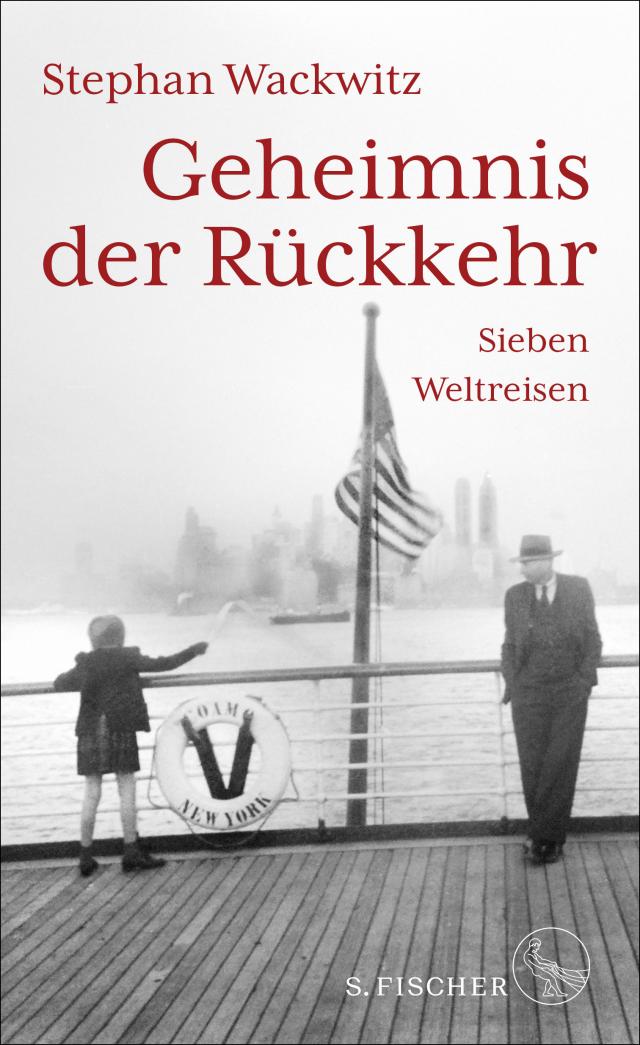
In „Geheimnis der Rückkehr“ beschreibt Stephan Wackwitz in Form von „personal essays“ seine „Sieben Weltreisen“ – es ist ein intellektueller Genuss, dieses niveauvolle Bildungsmemoir zu lesen. Wir folgen dem Autor auf den Wegen, die er in der Welt im Auftrag des Goethe-Instituts zurücklegte. Dabei bestechen seine feinen Stadtbeschreibungen, ob es nun Tokio oder Krakau, New York oder Bratislava war, wo er Halt machte. Nicht nur Städte, sondern auch persönliche Begegnungen spielen eine Rolle sowie die Denker und Philosophen, die Stephan Wackwitz seit seiner Jugend prägten.
Was mich an der Lektüre besonders gefesselt hat, ist das Bewusstsein, das der Autor wachzurufen vermag: Es gibt so viele Perspektiven auf das Leben, wie es fremde Gewohnheiten und Ansichten gibt, denn Wackwitz schreibt, „ dass es so viele Wahrheiten über die Welt gibt, wie sich Menschen auf ihr befinden“. Wenn er von „Rückkehr“ spricht, meint er ein „Geheimnis“, das uns alle angeht:
„Das Geheimnis der Rückkehr liegt darin, dass niemand als derselbe oder dieselbe irgendwohin zurückkehrt. Aber auch darin, dass alle Ursprünge, kaum hat man eine Weile nicht hingesehen, sich unwiederbringlich entfernt haben von ihrer Ursprünglichkeit. Weggang und Rückkehr machen die Welt unberechenbar“, so der Autor in seinem Buch.
Gerade im „Super Wahl-Jahr 2024“, wie es in den Medien großspurig angekündigt ist (aufgrund der nahenden EU-Wahlen im Juni und den Nationalratswahlen in Österreich im Herbst), ist es wichtiger denn je, sich eine eigene Meinung bilden zu können. Dazu regt das Buch an, denn Stephan Wackwitz selbst entpuppt sich zunächst als pietistischer, braver Schüler eines Konvents, der zum überzeugten Anhänger von Jung und Marx wird. Besonders die Gedanken des amerikanischen Philosophen Richard Rorty bringen einen Wendepunkt, da Wackwitz erkennt, dass er nicht mehr nach umfassenden, alles erklärenden Welterklärungen suchen muss. Nicht Letztbegründungen, sondern „ein immer größeres Repertoire alternativer Beschreibungen anzusammeln“, wird ihn fortan prägen. Er zeigt, wie wichtig die Lektüre von Denkern und die Begegnung mit Kunstschaffenden ist, dass es ganz und gar nicht stimmt, dass wir ohnmächtig den Dingen zusehen müssen. „Wir Kulturleute sollten aufhören, uns einzureden, wir wären ohnmächtig. Immerhin blicken wir gemeinsam und erstaunlich klar in die Abgründe unserer Zeit. Eine Zeit, in der wir mit unseren Mitbürgern Kämpfe ausfechten, von denen mancher meinte, dass sie längst ausgefochten seien (…) Die Liste des Unbehagens ist lang. Aber … das ist die gute Nachricht, wir schauen in diese Abgründe nicht allein. Wir sind nicht machtlos noch ohnmächtig“, schreibt etwa die zeitgenössische deutsche Intellektuelle Mely Kiyak. Und mit diesem erhellenden Gedanken möchte ich die kurze Einladung schließen, das „Geheimnis der Rückkehr“ zu wagen, denn zurückkehren bedeutet, sich in Beziehung zu setzen, wie dieselbe Intellektuelle schreibt: „Gesellschaft bedeutet in Beziehung zueinander zu leben. Die Vorstellung, dass immer das Gegenüber etwas verändern muss, damit man selbst zufriedener wird, ist ein sehr hilfloser Gedanke.“
Die glänzenden Beobachtungen von Stephan Wackwitz treffen genau diesen Punkt: Aufbrechen und Wiederkehren bilden eine große Erzählung, die Ohnmacht und Hilflosigkeit besiegt: „Das Glück besteht darin, zu leben wie alle Welt und doch wie kein anderer zu sein“ (Simone de Beauvoir).

Die japanische Autorin und Lyrikerin Hiromi Ito wurde seit den Siebzigern des letzten Jahrhunderts für ihre Performances und feministischen Werke bekannt und galt als "Schamanin der Poesie". Seit den Neunzigern lebt sie mit ihrem Mann, einem englischen Künstler, und ihren drei Kindern in Südkalifornien. In „Hundeherz“ erzählt Ito von ihrer sterbenden Schäferhündin Take, während sie in Japan vom geliebten Vater Abschied nehmen muss.
Die ungewöhnliche Familienkonstellation besteht aus den drei Töchtern Kanoko, Sarako und Tome; außerdem gehören noch der streng riechende Schuppenpapagei Pi-Chan, der fünfjährige Papillon-Rüde Nico und ein zunächst nur kurz als "ziemlich widerwärtiger Hundehasser" eingeführter Ehemann dazu, von Beruf Künstler und schon in die Jahre gekommen. Zentrum der Geschichte und der Familie ist aber Take, denn sie ist die Besitzerin des titelgebenden „Hundeherzes“.
Hiromi Ito beschreibt mit viel Liebe die zunächst sehr aktive Take, die mit ihren jugendlichen 40 Kilo im Stande war, sowohl Frauchen als auch die drei Mädchen gegen jedermann zu verteidigen. Nun aber ist sie alt und mit großer Einfühlsamkeit begleitet die Familie die Hündin über die letzten Monate hinweg, als der Verfall voranschreitet. Mit Geduld, ohne Scham und ohne Scheu ist von den Ausscheidungen die Rede, als Blase und Schließmuskel des Tieres versagen… Alles ist sehr lebensnah und realistisch dargestellt, weshalb es für die Lesenden oft Überwindung kostet, den Beschreibungen zu folgen… Am liebsten würde man wegsehen und sich die Nase zuhalten, doch zwingt uns die Autorin dazu, zugeben zu müssen, dass das allmähliche Nachlassen der vitalen Funktionen des Körpers zum Leben dazugehört, dass alles erträglich wird, wenn Humor und Zuwendung dominieren. Dies ist auch das Mittel im Umgang mit Schmerz: Egal, ob wir einen geliebten Menschen oder einen treuen Begleiter in Gestalt eines Hundes verlieren, dürfen wir an die Worte Bertolt Brechts denken: „Will man Schweres bewältigen, muss man es leicht angehen.“ Diese Weisheit hat Hiromi Ito auf unvergleichliche Weise zwischen den Zeilen zu Papier gebracht: bei aller anscheinend simplen Art ihrer Beschreibungen steckt ein großer Lebensmut dahinter, die hilft, die „unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ (Milan Kundera), die Fragilität unserer Existenz zu meistern.
Indes stirbt in Japan Hiromi Itos Vater – und die Autorin kann nur ab und zu hinfliegen, aber nicht ständig bei ihm sein. Dieser Umstand belastet sie, doch sie weiß, dass der Vater seinen treuen Hund Louis zur Seite hat. Ihn wird Ito nach dem Tod des Vaters mit nach Kalifornien nehmen. Auf eigenartig mysteriöse, aber unaufdringliche und stille Weise führt die Autorin uns vor Augen, dass die Existenz von Mensch und Tier nebeneinander ein großer Reichtum ist: Sie pflegt die sterbende Hündin Take sozusagen stellvertretend für den todkranken Vater in Japan, dem sie nicht so beistehen kann, wie sie es eigentlich möchte. Deshalb verdoppelt sie ihre Bemühungen, wenigstens der Hündin das Hinscheiden so schmerzfrei wie möglich zu machen… Wir Leser bleiben nachdenklich zurück, denn Hiromi Ito versteht es, trotz allem die Schönheit zu vermitteln, die in einem „Hundeherz“ liegt. Wir erfahren zwar das Leid des nahen Todes, aber auch eine Art Hoffnung, die jedem Schmerz zugrunde liegt. Dies alles wird nur still angedeutet, wirkt darum jedoch umso länger nach. Die Introspektion in ein „Hundeherz“, wie Hiromi Ito sie in diesem schmalen Bändchen schafft, lohnt sich, gelesen zu werden, denn: „Die allermutigste Handlung ist immer noch, selbst zu denken. Laut.“ (Coco Chanel).

Der eindringliche Titel des neuen Romans der herausragenden Schriftstellerin Mely Kiyak hält, was er verspricht: Es geht um den Beginn des „schönen Teil des Lebens“ – doch welcher Teil ist dies? Ist es die biographische Etappe, in der wir beruflich und privat alles erreicht haben, was wir erstrebten? Oder ist es nicht vielmehr – wie hier suggeriert – jener dringlichste Lebensabschnitt, in dem wir unsere Liebsten besonders nahe bei uns spüren dürfen, wenn wir also fühlen, dass wir nicht alleine sind, dass unsere Leben mit Erzählungen erfüllt bleiben werden, nicht nur für uns selbst, sondern auch in Form von Erinnerung in den Gedanken anderer? Der schönste Teil ist der wichtigste, weil er einen Rückblick auf Vergangenes erlaubt, aber auch Hoffnung auf Weiterleben beinhaltet… Diese wunderbare Symphonie komponiert die Autorin Mely Kiyak, wenn sie vom Überlebenskampf ihres krebskranken Vaters erzählt, ohne je weinerlich oder klischeehaft zu werden. Mit großer Authentizität berichtet sie von den schwierigen Krankenhausaufenthalten und verwebt diese Episoden mit Geschichten aus der kurdischen Heimat ihres Vaters, der vor Jahrzehnten als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen war, um Kupferkabel mit giftigem Lack zu überziehen – wohl auch die Ursache seiner späteren Lungenkrebs-Erkrankung, sozusagen als „Gastarbeiter-Geschenk“ – ein Ausdruck, mit dem die Autorin sachte gesellschaftspolitische Kritik übt. Doch anstatt in Anklage und Schwermut zu versinken, erzählt Herr Kiyak, der sich eigentlich auf einen gemütlichen Lebensabend mit seiner Liebsten in der Türkei, wohin er zurückkehren wollte, gefreut hatte, der Tochter am Krankenbett in einem deutschen Provinzkrankenhaus Geschichten aus der eigenen Kindheit, die gut das Milieu und den Kontrast zur harten deutschen Realität ausdrücken, denn diese Berichte aus einer anderen Welt machen die Diagnosen und scheinbar sinnlosen Therapien zur Bekämpfung des weit fortgeschrittenen Krebses erträglich.
Der Krankenhauspsychologe schafft es, der Tochter Mely zu vermitteln, dass sie den Vater loslassen und seinen eigenen Weg gehen lassen muss; zwar ist die „fürsorgliche Belagerung“ der Familie rund um den Kranken rührend, aber der ganz eigene Prozess der Annäherung an das Sterben darf nicht gestört werden. Dies bedeutet zwar Ohnmacht für die Angehörigen, aber auch Zuversicht, dass die Liebe die Angst überwinden kann, wie es Jan Skácel einmal in den Versen ausgedrückt hat:
„alles schmerzt sich einmal durch /
bis auf den eignen grund /
und die angst vergeht /
schön die scheune /
die nach längst vergangnen ernten /
leer am wegrand steht.“
Dieses Buch spendet unglaublichen Trost, weil es nicht um den Tod, sondern um das Leben geht, selbst wenn die Krankheitserfahrung isolierend ist – zunächst natürlich für die Betroffenen selbst, dann aber auch für das gesamte familiäre Umfeld. Doch inmitten dieser schmerzhaften Erfahrung von Hilflosigkeit und Isolation, welche allem eine andere Dimension zu verleihen scheint, ist der Roman auch ein eindrückliches Zeugnis für die Macht des Erzählens. Und am Ende bleibt die Erkenntnis, wie Mely Kiyak es ausdrückt: „Man ist so einfältig in seiner Liebe“, aber auch: welch wunderbares Geschenk ist das Leben!
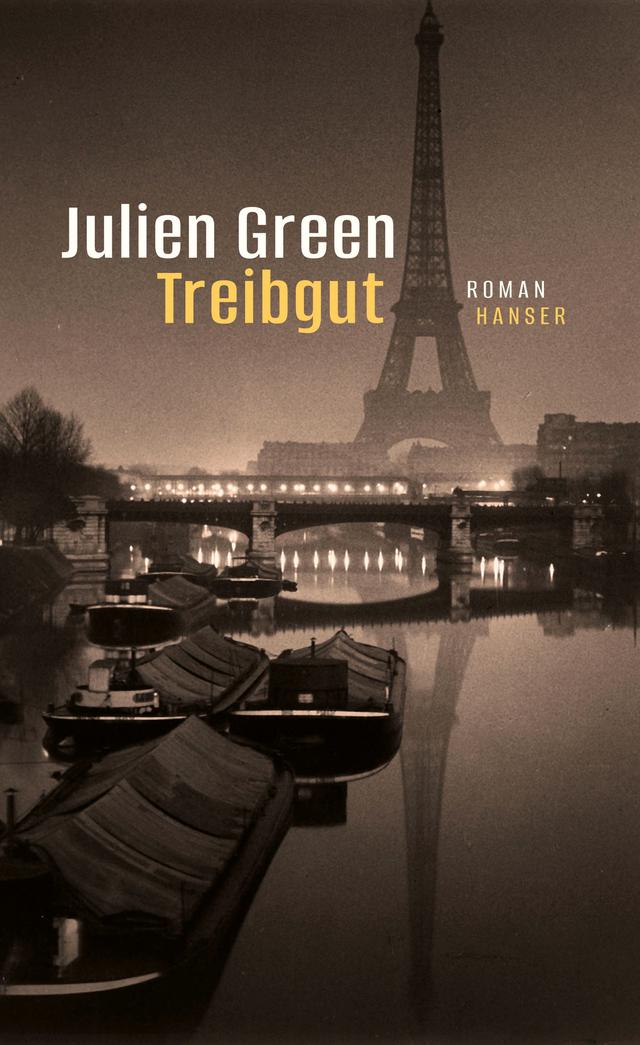
„Treibgut“ lautet eine der interessantesten Neuentdeckungen dieses Frühjahrs: Das Meisterwerk des amerikanisch-französischen Schriftstellers Julien Green ist nun neu übersetzt und auf Deutsch veröffentlicht worden. Das Verdienst, diesen Klassiker – der nichts an Aktualität verloren hat – mit seiner faszinierenden Sprache und Sogkraft lesen zu dürfen, kommt dem Hanser Verlag zu; und er scheint genau die richtige Zeit für die Neuauflage getroffen zu haben, denn ist im Augenblicke nicht ebenso – wie zu Erscheinen des Buches 1932 - die Kriegslage in Europa bedrohlich? Außerdem zeugt der Nahostkonflikt von einer instabilen Welt, die die bürgerlichen Werte zu erschüttern scheint.
In „Treibgut“ ist der Protagonist Philippe, der nachts am Ufer der Seine in Paris spaziert und zu feige ist, um einer Frau, die augenscheinlich in Lebensgefahr ist, zu Hilfe zu kommen, Emblem einer untergehenden Gesellschaft. Das Drama dieser gescheiterten Existenz wird verstärkt durch die unglückliche Beziehung zu seiner Frau Henriette, die er nicht liebt, und zu seiner Schwägerin Eliane, die ihn heimlich begehrt. Das Leben von Philippe Cléry, der Hauptfigur, treibt ziellos dahin…– eben wie das titelgebende „Treibgut“: Der gähnenden Leere seines luxuriösen Daseins hat er nichts entgegenzusetzen, es scheint ohne Halt und Sinn. In der Beschreibung des greifbaren Unglücks findet Julien Green eine wunderbare Sprache, die die Atmosphäre und das Milieu einzigartig auffängt: Eine innere und äußere Welt, die aus den Fugen geraten ist, aber dennoch vor der Wirklichkeit die Augen verschließen will. Green selbst schreibt, während der Verfassung des Romans 1930: „Die Nachrichten aus Deutschland haben mich in eine düstere Stimmung versetzt. Unruhen im Rheinland. Wie an einem Roman arbeiten, während der Friede bedroht ist?“ Die äußere Bedrohung Europas am Vorabend des Zweiten Weltkriegs wird durch die „Ménage-à- trois“, das Dreiecksverhältnis der Figuren, gespiegelt, die einen gemeinsamen Haushalt führen, geprägt durch Gleichgültigkeit und Hass auf der einen Seite wie durch Begehren und unterdrückte Leidenschaft auf der anderen: „Mit der Geduld von Ameisen – schreibt Green -, die auf den Ruinen ihres verwüsteten Baus arbeiten, errichteten sie von neuem eine fiktive Ordnung und verbrauchten dafür die gesamte gute Laune, zu der sie fähig waren.“
Philippe, Henriette und Éliane sind Vertreter eines kraftlos gewordenen Bürgertums geworden, das längst vor dem Abgrund steht. So wollte Green seinen Roman ursprünglich „Crépuscule /Dämmerung“ nennen: „Doch wessen Dämmerung? Des Bürgertums natürlich.“, erläutert der Autor 1931: „Nach einigem Nachdenken entschied ich mich für L´épave /Das Treibgut. Das Treibgut ist die ertrunkene Frau im ersten Kapitel; es ist aber auch die Hauptperson…“ Philippe ist es, der sich treiben lässt, gequält vom Gedanken: Würde er sich überhaupt verteidigen, bei einer Revolution; hat er es verdient, gerettet zu werden? – Es ist das verstörende Psychogramm einer zur Handlung unfähigen Seele; ein Mensch, der sich selbst beim Leben zusieht und dahintreiben lässt. Julien Green taucht ein in die Abgründe der menschlichen Seele, wobei er auch uns Lesenden viel über die Gegenwart mitzuteilen weiß. Es lohnt sich, diesen bedeutenden und sprachlich außerordentlich gelungenen Roman neu zu entdecken, um der allzu gemütlichen Gefahr zu entgehen, mit dem Strom der Allgemeinheit zu schwimmen, einem Treibgut gleich, das keine Kraft hat, sich zu widersetzen. Eine unbedingte Lese-Empfehlung also, die düster anmutet, aber gewinnbringend sein wird: „Ohne Schatten gibt es kein Licht; man muss auch die Nacht kennenlernen“ (Albert Camus).
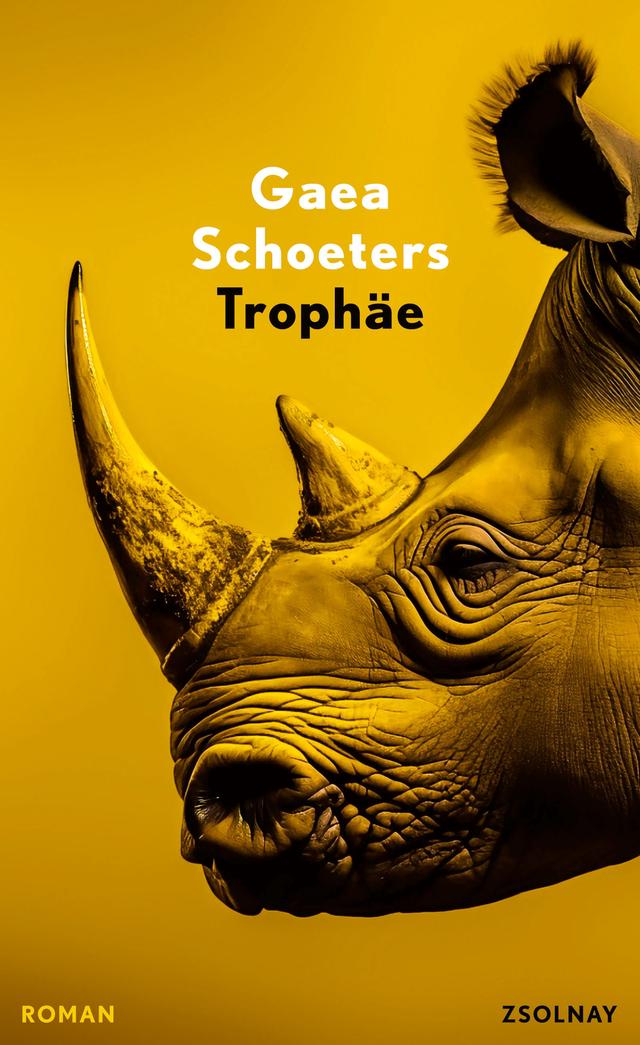
Die Niederlande waren das Gastland bei der – soeben zu Ende gegangenen – renommierten Leipziger Buchmesse 2024; Anlass genug also, um den kürzlich auf Deutsch erschienenen Roman „Trophäe“ der flämischen Autorin Gaea Schoeters zur Hand zu nehmen: Ein wirklich lohnenswertes Buch, das sich mit der Frage beschäftigt: Was ist ein Menschenleben wert?
Protagonist ist Hunter White, dessen Name ein Programm verspricht: Er ist der „weiße Jäger“, der nach Afrika reist, um die prestigeträchtige Jagd auf die „Big Five“ durch den Schuss auf ein Nashorn zu vollenden. Doch Wilderer durchkreuzen sein Projekt, das zum Scheitern verurteilt ist. Sein Freund Van Heeren macht ihn mit den sogenannten „Big Six“ vertraut: das „sechste Jagdobjekt“ ist der Mensch – ein Ansinnen, das sowohl Hunter als auch uns Leser sprachlos zurücklässt … Gaea Schoeters versteht es auf wunderbare Weise, auch jene in den Bann zu ziehen, die sich eigentlich nicht für Jagd interessieren, denn sie erzeugt eine Spannung, die viel mehr verspricht als eine krimihafte Handlung; philosophische Abgründe und eine Reise ins „Herz der Finsternis“ schweben zwischen den Zeilen wie auch die wiederkehrende Frage: Wie viel wiegt ein Menschenleben? Mehr als ein Tierleben? Wo liegt der Unterschied, wo die Grenze?
Gaea Schoeters selbst erklärt in einem Verlagsinterview: „Beim Scrollen auf Facebook stieß ich auf eine kleine Anzeige für eine Trophäenjagd auf eine seltene Steinbock-Art in Pakistan, in der es auch hieß, dass mit dem Geld für die Jagdlizenz ein Schutzprogramm initiiert werden soll. Eine seltene Spezies jagen, um die Umwelt zu schützen, das klang so paradox und ließ mich stutzen.“ So beginnt die Geschichte, die ein hautnahes Miterleben ermöglicht, wobei die faszinierende Natur Afrikas eine nostalgische Hintergrundbühne bildet, die eine einzigartige Atmosphäre schafft, denn der Mensch empfindet sich inmitten dieser Pracht als Fremdkörper, der mühsam die Zeichen zu deuten versucht, die der Urwald aussendet. Gleichzeitig wird die Jagd auch zu einer Spurensuche zu sich selbst: Hunter versteht, dass es – bei einer Verfolgung auf Augenhöhe – tatsächlich auch für den Menschen um Leben und Tod geht. Für den Leser erscheint dies zunächst als sinnlose Gewalt, die auch vor dem Äußersten - der Jagd auf einen Einheimischen – nicht zurückschreckt. Ist Hunter White nicht einfach im falschen Jahrhundert gelandet? Haben wir heute nicht fortschrittlichere Moralvorstellungen? Sollten Großwildjägertum und das Sammeln von Trophäen nicht längst überholt sein? Doch die Argumentation des Freundes Van Heeren ist bestechend: Das Geld (500.000 Dollar) kommt dem Stamm zugute, der quasi freiwillig den Deal eingeht. Zunächst fühlt sich der „Vorschlag so grotesk an, dass er zu einem perversen Scherz wird: Trophäenjagd als Naturschutz, Menschenjagd als Entwicklungshilfe“. So nimmt die Handlung ihren Lauf und die Jagd wird zu einer quälenden Selbsterkenntnis, führt zu verschwimmenden Grenzen zwischen Richtig und Falsch, was nur durch die wunderbaren Beschreibungen der Natur als krassen Gegensatz zu Gewalt und Grausamkeit erträglich scheint. Gaea Schoeters hat nicht umsonst ihrem Buch ein Zitat aus Joseph Conrads „Das Herz der Finsternis“ vorangestellt: „It was written I should be loyal / to the nightmare of my choice.“
Eine wirklich empfehlenswerte Lektüre, die viele Fragen aufwirft, ohne endgültige Antworten zu geben und die gerade deshalb lange nachhallt – leise und unaufdringlich, aber dafür umso eindrücklicher, denn „des Menschen Geist ist zu allem fähig – weil alles in ihm ist, die ganze Vergangenheit wie auch die ganze Zukunft. Schließlich, was war es denn, was wir da sahen? Freude, Furcht, Leid, Hingabe, Tapferkeit, Wut – wer konnte es sagen? – aber Wahrheit immerhin – Wahrheit, die ihres Zeitmantels entblößt war“ (Joseph Conrad, Herz der Finsternis).
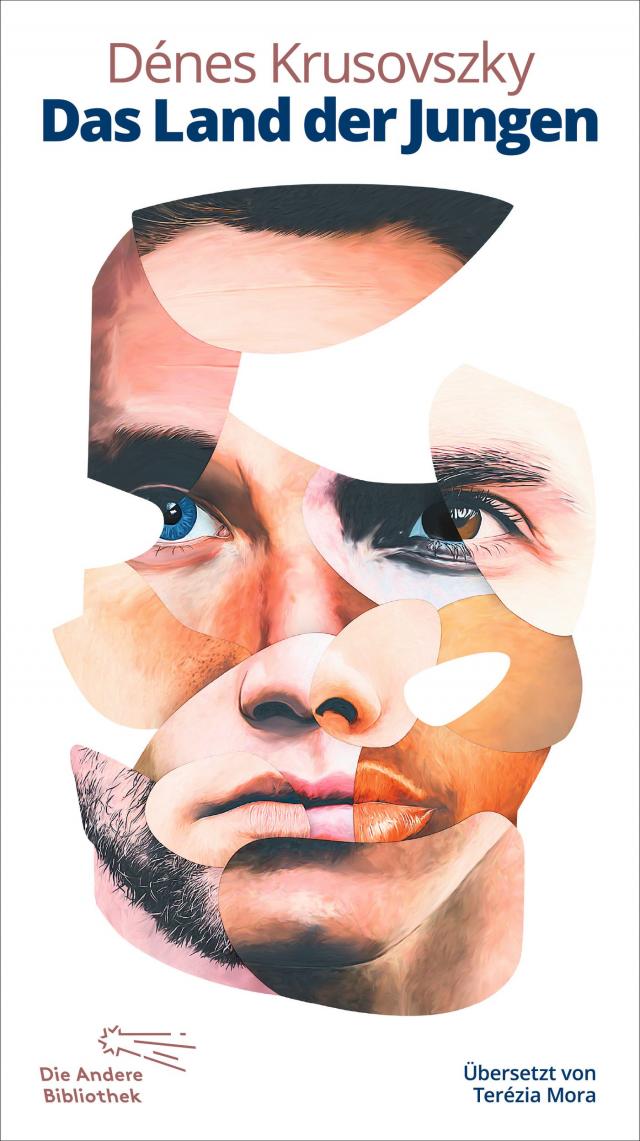
„Das Land der Jungen“ lautet der empfehlenswerte Erzählband des ungarischen Schriftstellers Dénes Krusovszky, der in diesem Frühjahr von Terézia Mora, selbst eine erfolgreiche Autorin (zuletzt mit „Muna oder die Hälfte des Lebens“ für den Deutschen Buchpreis 2023 nominiert), ins Deutsche übersetzt wurde. Es handelt sich um beeindruckende Geschichten, die allesamt einen Mann zum Protagonisten haben und die Zerbrechlichkeit der männlichen Seele im Fokus behalten. Darin beschreibt der Autor meisterhaft die sogenannten Kippmomente, also Wendepunkte, im Leben seiner Figuren, welche niemals der Lächerlichkeit preisgegeben werden, aber immer haarscharf das Erwachsenwerden in seinen verschiedensten Phasen beleuchten: Wann beginnt man, das „Land der Jungen“ zu verlassen, sich von der Kindheit zu verabschieden? Stolz, Scham, aber auch Gewalt und Trauer stehen im Zentrum der anrührenden Schicksale, die existenzielle Brüche zu verarbeiten versuchen. Zwar politisiert das Buch nicht – keine der Erzählungen schwebt die Moralkeule, doch Krusovsky gelingt es meisterhaft, einen tiefen Einblick in die Atmosphäre eines Landes – Ungarn - zu gewähren, das sich Victor Orbáns paternalistisches Männerbild auf die Fahne geschrieben hat; ein Bild, welches von seinen Protagonisten aber fortwährend in Frage gestellt und kontrakariert wird. Der Autor schlüpft mit feiner Ironie in immer neue Identitäten, die uns als Lesende fesseln und Empathie entwickeln und dabei alle Altersstufen durchleben lassen: Die Erzählungen sind nach dem Lebensalter der Protagonisten geordnet, wobei die Selbstillusion, die sie begleitet, die Unfähigkeit zur Kommunikation, die mangelnde Orientierung keine Generationsfragen sind – alle sind in der Tat davon betroffen -, sondern ein bröckelndes Männerbild zeigen, das Synonym für Unsicherheit ist. Die Worte Brechts „Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!“ kommen in den Sinn: „Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn / Deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende / Hat die furchtbare Nachricht / Nur noch nicht empfangen.“ Die aufgeheizten Debatten im „Land der Jungen“ zeigen, dass die Welt die Protagonisten überfordert: Sie suchen Gewissheiten, an denen man sich festhalten kann. Ist es legitim, sich in einer solchen Situation der Harmlosigkeit hinzugeben, ist – um noch einmal Bertolt Brecht zu zitieren – ein „Gespräch über Bäume“ fast ein „Verbrechen“? „Was sind das für Zeiten, wo / Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist / Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt! / Der dort ruhig über die Straße geht / Ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde / Die in Not sind?“(Bertolt Brecht)
Das Gefühl der Aussichtslosigkeit durchzieht die Erzählungen, die sich jedoch geschickt dem Bekenntniszwang entziehen: Zwar werden die Problematiken sichtbar, die düsteren Zeiten greifbar und anschaulich, doch wird die Rückzugsmöglichkeit angeboten – nicht zuletzt durch die Literatur: „Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, / der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, / während jene wartet, bis sie gefüllt ist. (…) Wenn du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, wem bist du dann gut? /Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, / wenn nicht, schone dich.“(von Bernhard von Clairvaux)
Welche Zeit im Jahr könnte besser für diesen Rückzug geeignet sein als die frühlingshaften Ostertage? Tatsächlich ist die erwachende Natur Sinnbild für ein „Land der Jungen“, wo österliche Hoffnung sich einen Weg durch die Ausweglosigkeit und Zerbrechlichkeit bahnt. Bücher wie „das Land der Jungen“ können unsere „Schale“ füllen – still und unbemerkt: das „Gespräch über Bäume“ ist kein Verbrechen, denn sie sind blühende Hoffnungsträger, die ein literarisches Eintauchen ins „Land der Jungen“ erst ermöglichen.
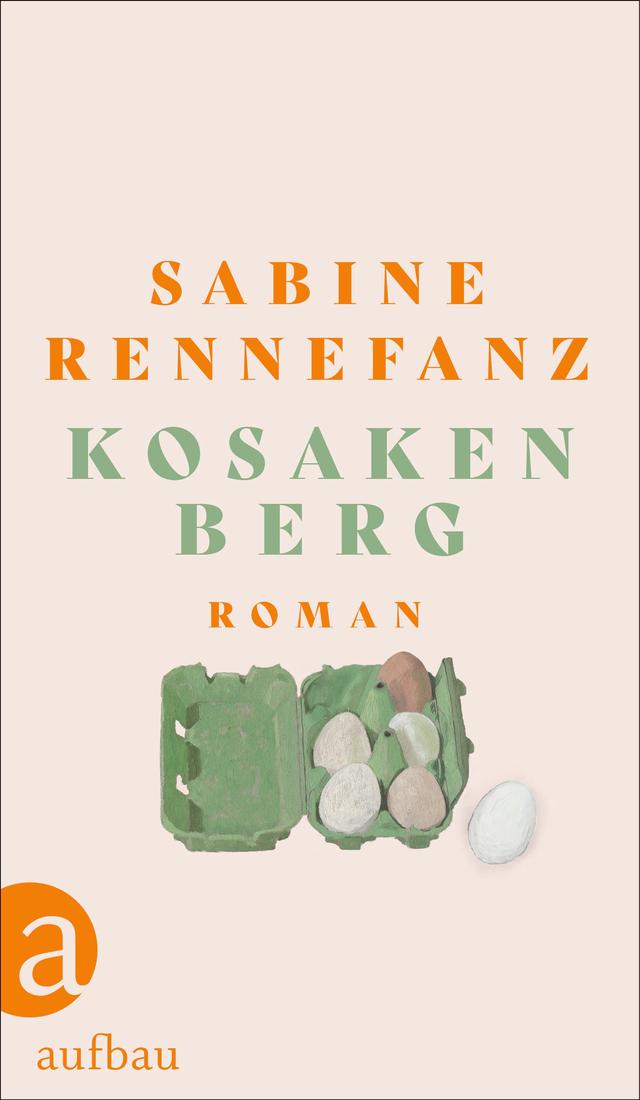
Sabine Rennefanz erzählt in ihrem kürzlich erschienen Roman „Kosakenberg“ eindrücklich, was Heimat bedeutet und wie man die Provinz hinter sich lässt: Die Protagonistin Kathleen hat ihr Dorf in Brandenburg gegen die Metropole London eingetauscht, wo sie als erfolgreiche Grafikerin beschäftigt ist. Doch immer wieder kehrt sie in den Osten Deutschlands zurück und zeigt damit, dass man sich nie ganz von den eigenen Wurzeln trennen kann – und es auch nicht sollte, denn sie prägen unsere Identität und unser Verständnis der Welt und Wirklichkeit, - und das vielleicht mehr, als wir zugeben möchten.
Die Autorin zeigt die starken Kontraste zwischen Stadt und Land, zwischen Ost und West, die Konflikte zwischen der ehemaligen DDR und der BRD, aber auch zwischen gebildeten und ärmlichen Schichten der Gesellschaft. Kathleen empfindet das Leben in Kosakenberg „wie Marmelade in einem Glas konserviert, ein anderes Jahrhundert“, so schreibt Sabine Rennefanz. So entflieht sie zunächst in eine andere fortschrittlichere Welt, kehrt aber immer wieder zurück, wobei jede Heimreise eine schmerzliche Erfahrung beinhaltet: Das ehemalige Zuhause ist ihr fremd geworden: „Heimreisen, das hatte ich inzwischen gelernt, waren Manöver durch energetische Felder. Es war, als kreiste man um einen Magnet, der einen entweder anzog oder abstieß.“ Das Weggehen bedeutet aber auch, die eigene Identität neu definieren zu müssen: „Ich hatte geglaubt, wenn ich mich lossagen würde, wenn ich das Haus verlassen würde, wenn ich ein Leben fern von dem Haus und jenen, die es bevölkerten, leben würde, wenn ich meine Wurzeln mit aller Macht herausreißen würde, dann könnte ich mich neu erfinden und jemand anderes werden. Nun vermisste ich das Mädchen von früher. Vielleicht ließen sich Wurzeln nie ganz entfernen. Vielleicht schaffte man das bei sich selbst gar nicht.“
So begleiten wir Kathleen bei diesem schmerzhaften Prozess, der dennoch tröstlich endet: Das letzte Kapitel heißt „Wiederkommen“ – also ein Versprechen, dass eine Versöhnung mit der eigenen Herkunft möglich ist? Gleichzeitig erfahren wir beim Lesen sehr viel über die Atmosphäre während der Wendezeit in Deutschland, also nach dem Fall der „Mauer“ und der Wiedervereinigung von DDR und BRD. Nicht nur die politische, auch vor allem die persönliche Vergangenheit lässt sich nicht abstreifen – Sabine Rennefanz erzählt nostalgisch und eindrücklich über Erfahrungen, die als Teil von uns das Leben immer begleiten werden und die Fragen nach Familie, Herkunft und Rückkehr hallen lange nach, auch nach der Lektüre, die übrigens hervorragend in die aktuelle frühlingshafte Zeit um Ostern passt, denn auf eine „österlich“ anmutende Kuriosität sei hingewiesen: Auf dem Cover des Buches ist eine Ei-Schachtel abgebildet; Eier galten in Kosakenberg nämlich als willkommenes Zahlungsmittel.
Wenn wir uns selbst ein Ostergeschenk machen möchten, dann sollten wir am Lesen bleiben: Die Tür der „Auferstehung“ wird sich auch für uns öffnen, wenn wir die Einladung zum Mit-Denken annehmen, denn: „Gut lesen“, wie Friedrich Nietzsche es ausdrückte, bedeutet, „langsam, tief, rück- und vorsichtig, mit Hintergedanken, mit offen gelassenen Thüren, mit zarten Fingern und Augen lesen“. - Was daraus folgt? „Wer nicht durch die „Thür“ tritt, ist selbst schuld. Oder auch: Das Geheimfach ist offen – für alle, die lesen wollen.“ (Ina Hartwig)
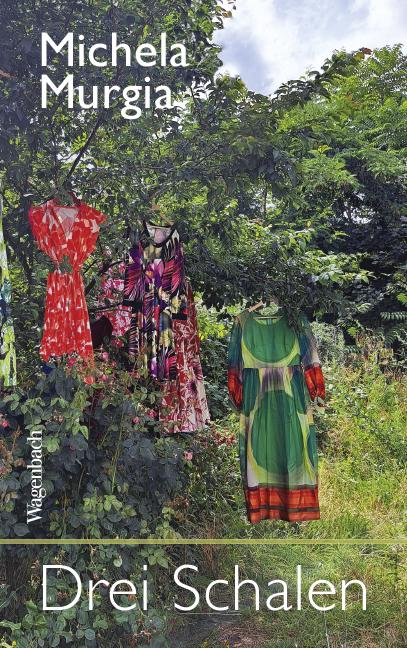
Eine wahre Perle der italienisch-sprachigen Literatur ist vom Wagenbach Verlag kürzlich ins Deutsche übersetzt worden, nämlich der Erzählband „Drei Schalen“ der berühmten, leider zu früh im letzten Jahr verstorbenen, Star-Autorin Michela Murgia. Darin verwebt sie autobiographische Erlebnisse mit vielen anderen Elementen, die ihr zeit ihres Lebens am Herzen lagen – und vor allem eint alle Protagonisten ihrer Geschichten der Umstand, „Opfer“ eines radikalen Umbruchs im eigenen Leben geworden zu sein. Doch gerade aus dieser „Opferrolle“ befreit Murgia die Menschen, denn gerade im Augenblick, wo alle Gewissheit brüchig wird, ist es möglich, zu kämpfen, um die eigene Würde und Identität zu bewahren. Die sardische Autorin versteht es meisterhaft, dass wir für diese Figuren – im gewöhnlichen Jargon würden sie als „gescheiterte Existenzen“ gelten – Empathie entwickeln, während sie ums Überleben ringen und Auswege aus dem Tunnel suchen. Die titelgebende Geschichte „Drei Schalen“ erzählt etwa von einer Frau, die verlassen wurde und ihre Trennung buchstäblich „nicht verdauen“ kann. Rettung bieten „drei Schalen“, in denen sie die Ration Essen für jeden Tag aufteilt – gerade genug, um zu leben, und nicht mehr, als sie tatsächlich im Magen behalten kann. Das Ritual der „drei Schalen“ rettet sie vor dem Tod; sie hat für sich einen Modus gefunden, um mit dem Unerklärlichen umzugehen. Es geht der Autorin darum, eine kontrollierbare Situation zu erschaffen, um der unkontrollierbaren Katastrophe im eigenen Leben – oder, im Falle der Corona-Pandemie, im Leben aller – zu entgehen.
Ausgehend von der eigenen autobiographischen Erfahrung der Entdeckung eines unheilbaren Nierentumors – Murgia ist im August 2023 mit nur 51 Jahren daran gestorben -, lesen wir zwölf Geschichten: 12 wie die Monate eines Jahres, von daher auch der Untertitel: „Rituali per un anno di crisi“, der in der deutschen Übersetzung – aus mir unerfindlichen Gründen – ausgelassen wurde. Die Autorin möchte eine Hilfestellung bieten für ein „Jahr der Krise“ – und wer möchte verneinen, dass wir sozusagen von einem „Jahr der Krise“ ins nächste Krisen gebeutelte Jahr schlittern, von der Corona-Pandemie zum Ukrainekrieg, von der Inflation und Teuerung zum Israel-Konflikt?
Ich kann mich dem Urteil von Roberto Saviano – Autor des kürzlich auch auf Deutsch erschienenen Bestsellers „Falcone“ – nur anschließen, wenn er sagt: „Michela Murgia verfügte über das großartige Talent, Dinge wirklich verändern zu können.“ Die Rituale, die Murgia vorschlägt, bestehen darin, dem Wahnsinn des Alltags mit Energie und Widerstand zu begegnen, ob es sich nun um eine plötzliche Diagnose der Krebserkrankung handelt oder ob um Beziehungsprobleme und Pandemie: Der Tod ist gegenwärtig und Murgia schafft es, selbst darin eine Alltäglichkeit zu schaffen: Wir alle wissen, dass wir vergänglich sind und sterben werden – der Tod sollte also keine Bedrohung sein, sondern eine Notwendigkeit, der wir uns früher oder später stellen müssen. Trauer und Trost vermischen sich im Abschied – wobei zwischen den Zeilen immer wieder der Abschied durchscheint, den die Autorin selbst mit diesen letzten Erzählungen von ihren Lesern nimmt. Dies schafft eine unglaubliche Atmosphäre – eine Beziehung, die zwischen den Lesern und der Autorin entsteht und die vielleicht – und verständlicherweise – im italienischen Original noch besser ausgedrückt wird als in der deutschen Übersetzung. Unendlich dankbar bin ich dafür, dass sich die italienische Autorin noch in den letzten Wochen vor ihrem Tod an Krebs diesen Text abgerungen hat, denn die Menschen, die wir in diesen Geschichten kennenlernen, sind ein Spiegel unserer Selbst, unserer Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit. Die zwölf ineinander greifenden Geschichten sind also wie die „Drei Schalen“, die uns zum emotionalen Überleben auch inmitten von Katastrophen zwingen. Mögen sich diese Schalen mit jener Lebensweisheit füllen, die Michela Murgia ausgezeichnet hat, wenn sie schreibt: „Die Bindungen waren ohnehin da, und vielleicht ist die einzige Möglichkeit, sie zu sehen, wenn die Codes, mit denen wir sie entschlüsseln, nicht mehr da sind, die Literatur. Was man nicht versteht, was man nicht sieht, was man nicht aussprechen kann, kann man nur durch Geschichten wieder sehen."
Abschließend möchte ich nochmal an den Anti-Mafia-Autor Roberto Saviano erinnern, der in der Literatur Murgias einen „Akt der Befreiung“ gesehen hat – denn sie war Italiens unkonventionellste Intellektuelle als öffentliche Gegenspielerin des rechtspopulistischen Regimes von Giorgia Meloni. Sie hatte die wunderbare Fähigkeit, Widersprüche zu integrieren: es gelingt anhand von „drei Schalen“, also von Ritualen, die eine Strategie sein können, für sich selbst stimmig und souverän mit der zusammenbrechenden Welt umzugehen.
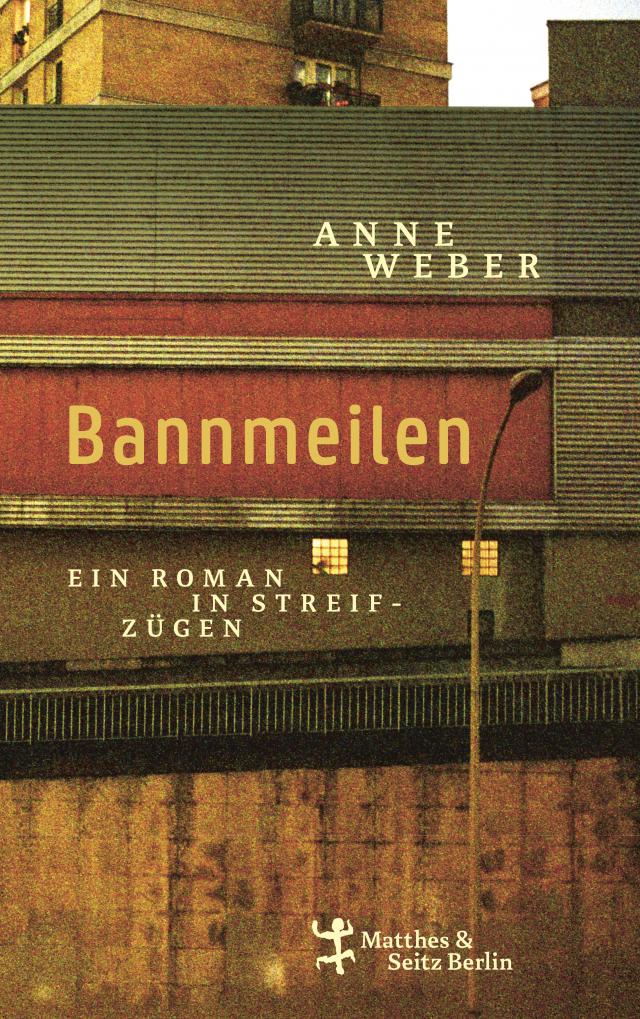
Im neuen Roman von Anne Weber geht es um die Pariser Vororte, die berüchtigten „Banlieues“, übersetzt: „Bannmeilen“. Seit rund 40 Jahren lebt die deutsche Schriftstellerin in Frankreich; nun hat sie sich zusammen mit ihrem Freund, dem Filmemacher Thierry, dessen Vater aus Algerien stammt, zu Fuß auf den Weg gemacht, um die Pariser Vorstädte zu erkunden. Das eigentliche Projekt bestand darin, Streifzüge in diese allzu gern vergessene Gegend zu unternehmen, um die Auswirkungen der Vorbereitung für die Olympischen Sommer-Spiele, die ja 2024 in Paris stattfinden werden, zu untersuchen. Es eröffnet sich eine fremde Welt, geprägt von Müll, Leerstand, heruntergekommenen Wohnblocks. Gleichzeitig drängt sich die Frage auf: Wer ist „Franzose“ oder „Französin“? Ein Pass reicht nicht, um die bis heute nicht aufgearbeiteten sozialen Gräben zu überspielen: Verfehlte Integrationspolitik macht diese Vororte zu Gegenden, wo der Drogenhandel und die Arbeitslosigkeit florieren, wo Menschen leben, die geflüchtet und doch nie angekommen sind: „Wo sind sie alle, die aufgebrochen und nie angekommen sind? Entre deux ailleurs, zwischen zwei Woanders, sagte Thierry.“
Doch entdecken Anne Weber und Thierry ein kleines Café, das inmitten von Trostlosigkeit und Mangel an Perspektiven einen Ort der Geborgenheit darstellt: „Ich freue mich jedes Mal darauf - schreibt die Autorin -, hierherzukommen, diese Menschen wiederzusehen, an diesem einzigartigen Zufluchtsort zu verweilen, ohne den (...) einige der Bewohner dieses Viertels vielleicht schon an Einsamkeit und Trübsal gestorben wären.“
Dieser „Roman in Streifzügen“, wie es im Untertitel heißt, liest sich wie eine Reportage und wir gewinnen als Leser einen tiefen Einblick in das vielschichtige Gesicht dieser verrufenen Vorstädte, die sich übrigens klar abgrenzen vom „Paris intro muros“ (dem noblen Paris innerhalb der Stadtmauern), wie es den Touristen dargeboten wird. Schockierend klingt die Nachricht, die Anne Weber wie beiläufig einfließen lässt: Während des aktuellen Baus des Olympischen Dorfes, das die internationale Aufmerksamkeit auf die französische Metropole im Sommer 2024 auf sich lenken wird, werden die derzeitigen Bewohner des Viertels (außerhalb der „Mauern“) ausquartiert, um der Prominenz Platz zu machen: „Da sie keine Aussicht auf Papiere haben, werden sie sich ein anderes Schattenloch suchen, (...) bis zum letzten großen Schatten, dem einzigen, der uns alle gleichmacht, besser als jede Revolution.“
Obwohl dies alles in unmittelbarer Nachbarschaft stattfindet, mutet die Welt in den „Bannmeilen“ uns fremd und fern an. Und trotzdem: es sind Orte, an denen Menschen mit einer Geschichte leben, mit einer individuellen Würde – und Anne Weber gelingt es auf ihren Streifzügen, diese Menschen nahbar zu machen, Freunde zu finden, wenn sie schreibt: „Wir sind alle, denke ich jetzt, weder das, was wir sein wollen, noch was andere in uns sehen, sondern eine unentwirrbare Mischung aus beidem, und was wir für freie Entscheidungen halten, ist oft nur das Ergebnis einer Kettenreaktion, die von Generation zu Generation weiterläuft und mal in diese, mal in jene Richtung ausschlägt.“ Sie erzählt von Begegnungen, die ihre Sicht auf das Leben verändern, das nicht nur „schwarz und weiß“ ist, das sich nicht in „Gut und Böse“ aufteilen lässt, sondern unglaublich viele Nuancen besitzt. Emblematisch hierfür ist das erwähnte kleine Café, das sich als Ort der Toleranz und des bedingungslosen Miteinander entpuppt. Dies hilft, „den Rest zu ertragen“, wie Rachid, der Besitzer des Lokals erzählt, „… dass er nebenher noch eine andere Tätigkeit hat, der er mit Leidenschaft nachgeht: Er hat einen kleinen Verlag gegründet, in dem er eine Zeitschrift herausgibt, die er im Internet vertreibt. (…) Das Gute sei, sagt Thierry, dass er sich einen kleinen Raum für sich geschaffen habe. Ja, das brauche er, sagt Rachid. An etwas anderes denken. Das sei wichtig … Das helfe ihm, den Rest zu ertragen.“
„Bannmeilen“ ist ein Buch, das zum Hinschauen einlädt und zum Nachdenken: ein Buch, das ein „Mysterium“ enthält, wie Anne Weber abschließend bemerkt: „Vielleicht ist das, was ich von unseren langen Wanderungen werde erzählen können, nichts als ein mit Nachdruck übermitteltes Mysterium“. Eine unbedingte Lese-Empfehlung, für all jene, die an das Mysterium glauben – an das Wunder, durch die anderen – die Bewohner der Banlieue (der Bannmeilen) ¬ – sich selbst ein wenig besser verstehen zu können: „Ich habe gemerkt, das Wunder, auf das ich so lange gewartet habe, bin ich selbst.“ (Selma Lagerlöf)
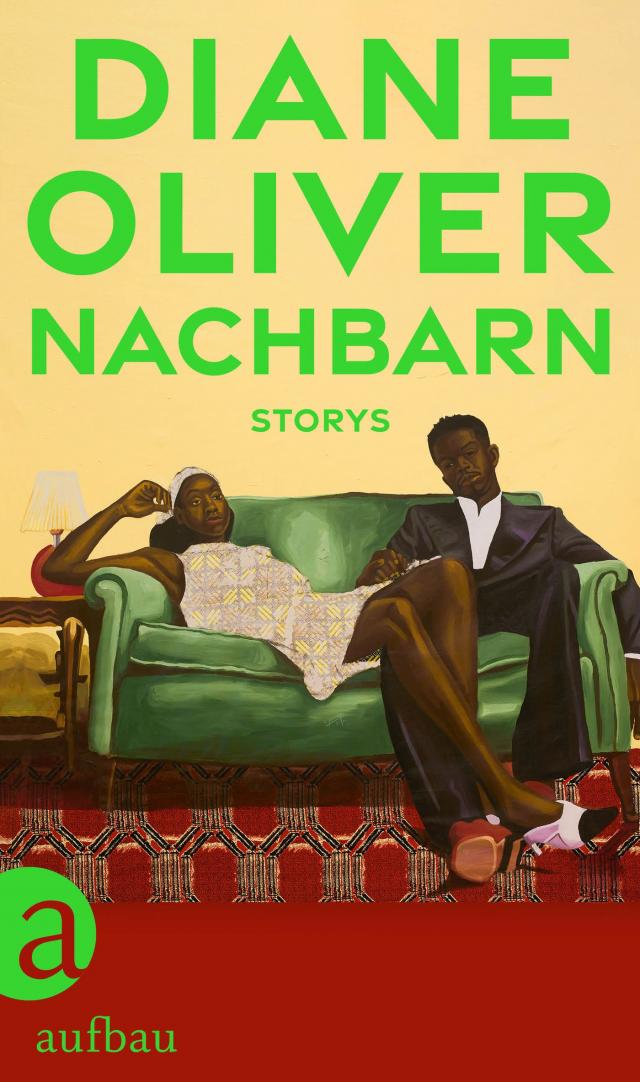
"Nachbarn" ist der ansprechende Titel einer Neuentdeckung aus den sechziger Jahren, nun erstmals auf Deutsch erschienen; ein Buch, das seiner Zeit voraus war... Es ist noch immer hochaktuell. Die afro-amerikanische Autorin, Diane Oliver (1943–1966), ist leider viel zu früh bei einem Motorradunfall verstorben; mit knapp 22 Jahren verfasste sie diese vierzehn Erzählungen, die so ergreifend sind, dass man erahnen kann, welches Talent verloren gegangen ist und wie viel Großes auf literarischem Niveau sie in der Welt noch hätte leisten können. "Nachbarn" sind Menschen, die unsere Zeitgenossen sind und uns nahe, aber doch auch fern in der ihr eigenen Lebensgeschichte, die wir - auch wenn wir Wand an Wand, also "nebenan", wohnen - kaum in ihrer Tiefe zu erfassen vermögen. All dies fängt Diane Oliver ein, wenn sie über die sozialen Umbrüche im Amerika der sechziger Jahre schreibt. Die „Storys“, wie die Kurgeschichten im Untertitel heißen, erzählen von der Problematik der afroamerikanischen Emanzipation, aber auf eine so beeindruckende, weil erstaunlich nüchterne Weise, dass wir im Heute die Gefühle und Schwierigkeiten von damals nachvollziehen können. Ist es richtig, den kleinen Bruder als einziges farbiges Kind auf die weiße Schule zu schicken? „Die Weißen bedrohten sie nun schon seit drei Wochen. Einige Briefe wandten sich an die Familie, die meisten jedoch waren an Tommy selbst gerichtet. Ungefähr einmal pro Woche schrieb jemand mit der immer selben Handschrift, Tommy solle mittags lieber nicht in der Schule essen, sonst würde er vergiftet.“ Diese Passage aus der Titelgeschichte "Nachbarn" erzählt, welchen Gefahren Kinder und Jugendliche schwarzer Hautfarbe ausgesetzt waren, wenngleich Gerichtsurteile Anfang der 1960er nun auch im Süden der USA erlaubten, Bildungseinrichtungen zu besuchen, die bislang Weißen vorbehalten waren. Für die Bürgerrechtsbewegung waren es zwar Erfolge, aber gesellschaftlich bedeutete es noch immer, der Angst, der Demütigung ausgesetzt zu sein: Was richten diese unbedingt notwendigen Schritte auf dem Weg zur Gleichberechtigung ganz konkret mit den Familien an, die im Alltag nach wie vor mit Rassismus und Armut zu kämpfen haben? Schließlich bleibt die brennende Frage: Gibt es einen Unterschied zwischen dem, was für die Gesellschaft am besten ist, und dem, was der Einzelne erlebt und benötigt? Der Autorin geht es immer um beides, um das Politische und das Persönliche, und damit um allgemeingültige Fragen unserer Existenz und unseres Miteinanders.
Was mich bei der Lektüre besonders beeindruckt hat, ist, dass es keine Larmoyanz gibt, keinen sentimentalen oder pädagogisierenden Unterton - und das zu meistern, bei einem solchen Thema, ist ein wahres Kunststück. Allzu leicht wäre es, die Betroffenen als Opfer darzustellen; aber Oliver gelingt es, die Menschen als das darzustellen, was sie sind: keine Helden, sondern Menschen mit Fehlern, geprägt von der Gesellschaft und vom sozialen Umfeld. Die Rassentrennung bleibt spürbar, auch wenn sie politisch überwunden scheint. Dass diese Geschichten uns heute noch fesseln, wenngleich sie im Amerika der 60ger Jahre situiert sind, beweist, dass sie ein Stück Weltliteratur sind, die niemals vergangen ist, sondern im Hier und Jetzt das gelebte und belastete Leben einfängt - und zwar jener, die "Nachbarn" sind, die wir als solche wahrnehmen und die uns deshalb nicht gleichgültig sein können. Und so bleibt der Wunsch, uns von der „Magie“ in Bann ziehen zu lassen, von dem Tayari Jones in ihrem Nachwort am Ende des Buches spricht: „Fiktionales Schreiben kann eine transzendentale Erfahrung sein. Hat es nicht etwas von Magie, dass wir unsere Fantasie in Buchstaben auf einer Seite verwandeln, die lesbar und von Dauer sind? Ich glaube, dass die zweiundzwanzigjährige Diane Oliver diese Geschichten mit ihrer Niederschrift an die Luft, das Wasser, den Boden um uns herum weitergegeben hat. Wir alle haben Vorfahren, die wir leider nie kennenlernen durften, deren Vermächtnis wir aber in uns tragen. Ihre Erinnerungen nisten inmitten unserer eigenen. Ihre Worte sind unsere Worte, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht.“ – Was kann es Schöneres geben, als uns auf diese unsere "Nachbarn" - ob gegenwärtig oder vergangen - einzulassen? Denn „dafür sind Bücher ja da“, um nochmal Tayari Jones zu zitieren: „– um den neuen Menschen zu erzählen, was zum Teufel passiert ist.“
„Nachbarn“ lädt uns ein, „das Leid anderer zu betrachten“, wie Susan Sontag es formuliert hat: Die literarischen Bilder, die Diane Oliver schafft, zeigen Menschen, die verstört, versehrt sind, aber als Lesende kann ich nicht nur das sehen, was vor mir ist, sondern muss auch versuchen, die Person wieder zu rekonstruieren, die sie einmal war: ein Mensch mit einer unantastbaren Würde.